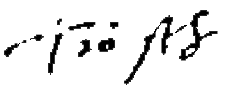

|
|||||
|
|
|
Allgemein Home Sitemap
Genealogie
Lesestoff
Quellen
|
Es war im Herbst des Jahres 1897. Mein Traum der Jugend, mein Traum
während meiner Lehrzeit, sollte in Erfüllung gehen in der Form
meiner Reise nach Paris. Freiheit und eigenes Erleben und Streben konnten
nun beginnen. Seit einem halben Jahr war ich mit meiner Schriftsetzerlehre
zu Ende gekommen. Mein Entschluss war gefasst, meine knappe Ausrüstung
durch meine Lohnersparnisse in Ordnung. Ich konnte getrost das Wagnis
unternehmen, nach Paris zu fahren, um dort mein Fortkommen zu suchen. Mein
Onkel in Paris bot mir die Ermunterung, im Trubel der Grossstadt festen Fuss
zu fassen.
Mein Vater ist nur 45 Jahre alt geworden.1 Reichtum gab es nicht in unserer Familie. Die
Hauptlast musste seit Jahren schon unsere Mutter übernehmen und
für den Unterhalt und das Vorwärtskommen sorgen. Ich hatte nach
meinem Schulaustritt mein Schicksal selbst zu meistern, wie viele Tausende
meines Alters. Das Geschick hat mir sogar den Besuch der Sekundarschule
verweigert, trotzdem ich die Fähigkeit dazu gehabt hätte. Der
Schulmeister Born in Herzogenbuchsee, mit dem meine Mutter nach Absolvierung
der ersten vier Jahre über den Eintritt in die Sekundarschule
verhandelte, behauptete, wenn man später nicht studieren könne,
habe die Sekundarschule keinen Wert. Er sagte dies, weil er wusste, dass bei
uns aus finanziellen Gründen ein Studium nicht in Frage kam. Er war
bestrebt, ein paar gute Schüler und Schülerinnen in seiner
Primarschule zu behalten. Bis zum Austritt aus der Schule hatte ich kaum ein
Wort Französisch gelernt.
Bei der Berufswahl erklärte mir ein Meister einer mechanischen
Werkstatt, ich sei zu «bring», zu wenig entwickelt. Ich hatte
damals im Sinn, Lokomotivführer zu werden, wozu mir die Lokomotiven
Anlass gaben, die ich täglich auf meinem Schulweg bewundern konnte.
Ich kam in der Folge zu einem Bauern nach Nods am Fusse des Chasserals, um
Französisch zu lernen. Zu was langt schon ein solcher Lehrgang in einem
Bauerndorf? Zu fast nichts. Ich musste beginnen, mir selber zu helfen. Ich
erreichte es, in einem Pensionsinstitut Französisch-Stunden zu nehmen.
Anderthalb Jahren gingen so verloren und dann dauerte es noch ein halbes
Jahr bis ich eine Lehrstelle als Schriftsetzer in der Buchdruckerei B.
Fischer in Münsingen fand.2
Diese Lehre war an die Vorschrift der Absolvierung der Sekundarschule
gebunden, doch dank der Kenntnis der französischen Sprache liess sich
Herr Fischer herbei, mich anzunehmen. Mein Wunsch, in das Zeitungs- und
Bücherwesen Eingang zu finden, ging in Erfüllung.
Mit 17½ Jahren3 kam ich in
die vierjährige Lehre, verdiente Kost und Logis beim Prinzipal und zwei
Franken Wochenlohn bei mehr als 60-stündiger Arbeitszeit. Mit
21½ war ich noch Lehrling mit zwei Rekrutenschulen als Ausbildung
(!).
Meine Meistersfrau versicherte mir, nun sei ich ein gemachter Mann, ich
verdiene mehr als ein Schulmeister! Bei einem Lohn von 30 Franken pro Woche.
– In späteren Jahren erklärte mir der Prinzipal Fischer, ich
sei sein bester Lehrling gewesen.
Für einen Schriftsetzer deutscher Zunge war es ein gewagtes
Unternehmen, in Pariser Druckereien Arbeit zu finden und mit
französischen Berufskollegen den Konkurrenzkampf aufzunehmen. Dort sind
die Arbeitsverhältnisse ganz andere, wozu noch die
Sprachschwierigkeiten hinzukamen. Schreibmaschinen gab es in den neunziger
Jahren sozusagen keine und es war eine schwere Aufgabe, als fremdsprachiger
Setzer in den fast nicht lesbaren Handschriften der Redaktoren und
Korrespondenten einer Zeitung zu arbeiten, wobei ja noch ein möglichst
fehlerfreier Schriftsatz geliefert werden muss. Einstweilen wurde daraus
noch nichts.
Die erste «Büez» fand ich schon am folgenden Tage auf der
Arbeitssuche. Die erste beste Druckerei der Nachbarschaft, eine kleine Bude,
musste Besuch aushalten und es langte mir zu einer kleinen Anstellung mit 2
Fr. Taglohn (!). Es war mir darum zu tun, möglichst rasch in eine
Druckerei zu kommen, um die Arbeitsmethoden der französischen
Druckereien kennenzulernen. Alles war hier anders als in der Schweiz. Dort
hielt es mich nicht lange, d. h. bis ich ein anderes Engagement gefunden
hatte. Auch diese Stelle war nicht viel wert. Fr. 4.– Taglohn. Arbeit
in einem Keller, mit Tiegeldruck (Tretmaschine). Ich wuchs schon besser in
die Pariser Verhältnisse hinein. «Il fallait se
débrouiller!»
Der grosse Dreyfuss-Prozess, der ganz Frankreich durcheinander brachte,
veranlasst durch die schwere Anklage Emil Zolas
«J’accuse!», verschaffte mir eine Stelle in einer grossen
Druckerei, Imprimerie du Siècle, wo 350 Setzer arbeiteten. Dort wurde
meine Stelle zu einer dauernden, das heisst, bis ich fand, es sei Zeit
weiterzukommen. London zog mich an, nachdem ich ein Jahr in Paris gearbeitet
hatte. Sprachen sind für einen Schriftsetzer und für den
Buchdruckerberuf wichtig, nebst den Berufskenntnissen.
In Paris hat mir dieses Berufsjahr viel geboten. Beruflich und belehrend gab
es viele Bildungsstätten, Paris und Versailles sind berühmte, sehr
schöne Städte mit ihren grossartigen Anlagen und Bauten,
Boulevards und Avenuen. Museen aller Art. Kunststätten, grosse
Druckereien, Arts et Métiers, Eiffelturm, Louvre, Kirchen usw.
Versailles enthielt damals eine weltberühmte Bildergalerie, darunter
die napoleonischen Schlachtenbilder ganz grossen Formats.
Die Familie meines Onkels Fritz Burri mit seiner Frau und seinem kleinen
12jährigen Sohn war mir eine wertvoller Stützpunkt in dem
turbulenten Paris. Mit dem kleinen aufgeweckten Pariser Cousin Georges
machte ich viele Ausflüge in all die Bildungsstätten der
Weltstadt. Mein Onkel hatte ein kleines Schuhwarengeschäft und
Reparaturwerkstätte auf dem Boulevard de la Villette. Er war ein sehr
fortschrittlich durchdachter Mann, mit dem sich interessante Diskussionen
entspannen. Diese Diskussionen waren für mich sehr anregend und
lehrreich. Er war ein eifriger Zeitungsleser. Trotz den nicht gerade
gesunden Verhältnissen der Grossstadt und den langen Arbeitszeiten, der
Laden blieb damals sonntags und werktags bis 10 Uhr abends offen, erreichte
er ein Alter von 85 Jahren. Sein Vater4 war ein Kleinbauer im Weissenried bei
Bützberg. Drei seiner Geschwister, worunter meine Mutter5, erreichten ein Alter zwischen 82
und 85 Jahren. Alle hatten ihr Leben lang ganz gehörige
Arbeitsbürden.
Nebst dem grossen Dreyfuss-Zola-Prozess, der Paris an den Rand einer
Revolution brachte, mit Demonstrationszügen aller Art, bis die
Militärkamarilla überwiesen und verurteilt war, hatte ich kleine
Abenteuer zu bestehen. Ein interessantes Intermezzo, das mir passierte, kann
ich anbringen: Ein hypnotisierte Frau verursachte mir ein Erlebnis.
In der Imprimerie du Siècle in Paris fand ich unter den zahlreichen
Velofahrern Kameraden, die geneigt waren, gelegentlich kleinere
Spazierfahrten mit Velos zu unternehmen, so zum Beispiel die Fahrt rund um
Paris, 33 Kilometer, entlang den damals noch vorhandenen grossen
Befestigungen, den «Fortifs». Ausserhalb dieser Befestigungen
befand sich ein unübersehbares Gelände von zirka 150 m Breite, als
freies Schussfeld gedacht. Die Velos in Frankreich hatten damals gar keine
Bremsen und auch keinen Freilauf, man musste mit den Füssen bremsen.
Einmal machte ich in einem Gespräch anheischig, von der Druckerei aus
im Zentrum von Paris in einer Stunde die Strecke beim Arc de Triomphe vorbei
durch den Bois de Boulogne und über die Avenue de St-Cloud der Seine
entlang zurückzufahren. Diese Strecke von nicht ganz 20 Kilometern
wäre an sich nicht schwer zu bewältigen gewesen; es ging aber von
der verkehrsreichsten Stelle der Stadt hinaus und dann wieder zurück
bis zum Boulevard Monmartre. Damals gab es noch keinerlei Autos, nur
Pferdebetrieb. An der Avenue de St-Cloud, an der Umkehrstelle, wurde eine
Kontrolle für meine Fahrt eingelegt. Nach Passieren dieser Kontrolle
fand ich die Avenue H. Martin total aufgebrochen im Umbau. Es war mir nur
möglich, rechts zwischen den Tramschienen zu fahren. Ich legte alle
Kraft ins Spiel. Da kreuzte eine einzelne Frau die aufgebrochene Strasse,
blieb zirka 50 Meter vor mir ausgerechnet zwischen den Tramschienen stehen
und starrte unverwandt auf den mit höchster Velogeschwindigkeit
ankommenden Radfahrer. Rein hypnotisiert muss die Frau gewesen sein. Ein
seitliches Ausweichen war mir unmöglich gemacht durch die
terrassenförmigen Absätze links und rechts. Ich dachte, die Frau
mache nur Spass und ziehe dann einen Fuss zurück, um mich
durchzulassen. Aber nichts derartiges tat sie. Als mein Vorderrad neben ihr
anlangte, versuchte ich den Schock zu mildern, indem ich die Frau mit beiden
Händen zu halten suchte. Der Schock war aber so stark, dass sie drei
Meter weit in die aufgebrochene Strasse geschleudert wurde, ohne weiteren
Schaden zu nehmen. Sie erhob sich, fand die Sprache wieder zum Schimpfen und
las die verstreuten Haarkämme zusammen. Ich blieb auch nicht stumm,
richtete meine Lenkstange und führ schleunigst weiter, denn meine Zeit
war sehr knapp.
Leider erlebte ich noch einen weiteren unerwarteten
Unfall. Auf dem Grand Boulevard des Italiens, beinahe am Ziel, traf ich zwei
Reihen Kutschen mit Pferden im Trab, eine fuhr links gegen mich, die andere
rechts in gleicher Richtung. Dazwischen war ein breiter Streifen der Strasse
frei. Unglücklicherweise fuhr vor mir ein leeres Kutschli in dem freien
Teil. Gerade als ich überholen wollte, riss der Kutschner sein Ross
herum zum Wenden und versperrte mir die ganze Passage, ohne einen Blick nach
rückwärts oder ein Zeichen zu geben. Ich hatte plötzlich nur
die Wahl, in das Ross hineinzufahren oder in den Wagen, da mein Rad keine
Bremse besass. Ich liess wieder die Lenkstange fahren vor dem Anprall, wobei
ich eine weichere Stelle auswählte. Das gelang mir zum schönen
Teil, aber meine Pedale, die Hosen und die Lenkstange waren die
Leidtragenden. Ich konnte von Glück reden, dass es so gut abgelaufen
war. Die kleine Wette war verloren. Das war weiter nicht schlimm, doch ein
merkwürdiges Erlebnis, kaum glaublich, aber wahr.
Das bremsenlose Velo hätte mich einmal in Pontoise, 40 Kilometer von Paris, in Lebensgefahr bringen können. Beim Besuche diese Stadt, die von der Seine durchschnitten wird, fuhr ich eine steile Strasse gegen den Fluss hinunter. Zuerst ging es ordentlich mit dem Bremsen mit den Pedalen. Die Strasse wurde aber noch steiler, doch ich sah die Sache nicht für gefährlich an. Nun begann aber die Geschwindigkeit des Rades zuzunehmen und ich sah den Moment kommen, wo die Geschwindigkeit so gross würde, dass ich die Pedale nicht mehr meistern konnte. Unten am Stutz lief eine Strasse quer zu meiner, mit einer Quaimauer und dahinter der breiten Seine. Mit aller Kraft suchte ich mit den Füssen die Pedale zu halten. Jeden Moment fürchtete ich die Katastrophe komme. Mit grösster Anstrengung brachte ich es doch noch fertig, unten den Rank zu bekommen – ohne Sturz und ohne Zusammenprall auf der Strasse mit irgend etwas. – Noch nach den vielen Jahren erinnere ich mich lebhaft der bösen Fahrt mit dem französischen Velo ohne Bremse.
Immer stand der Eiffelturm auf meinem Besuchsprogramm. Zweimal wollte ich dem wunderbaren Turm eine Visite machen, traf es aber daneben. Dafür konnte ich einmal vom Jardin d’Acclimentation mit einem Fesselballon 400 Meter hoch steigen und auf ihn hinabblicken. Dabei dachte ich, warte nur, du rennst mir nicht davon! Aber es ging an die 50 Jahre, bis ich seinen wunderbaren Bau und seine weltbekannte Aussicht erlebte.
1898 zog es mich fort, und zwar nach London. Per Velo fuhr ich
nach dem 180 Kilometer entfernten Dieppe, berühmt geworden durch einen
ersten Angriff der vereinigten Armeen gegen die Deutschen. Von dort ging es
auf einem kleinen Dampfer nach Newhaven auf der andern Seite des Kanals in
vierstündiger Seefahrt. Dann kam wieder das Velo zu Transportehren zur
Erreichung des 90 km entfernten London. Wenige Brocken der englischen
Sprache standen mir da zur Verfügung.
Als Mitglied der Pariser
Setzer-Typographia glaubte ich in London Arbeit zu finden, eventuell als
Französisch- oder Deutsch-Setzer oder als Drucker. Auch auf die
Aufnahme in die Londoner Society of compositors hatte ich gerechnet. Der
Sekretär dieser Gesellschaft erklärte mir aber, es seien 1300
Setzer auf dem Pflaster, was ich da noch wolle? Ich war am Hag!
Da war guter Rat teuer. Mit meinen wenigen Sprachkenntnissen und
beschränkten Mitteln war es mir unmöglich, auf eigene Faust in der
Riesenstadt nach Berufsarbeit Umschau zu halten. Zurückkehren wollte
ich nicht ohne die englische Sprache erlernt zu haben. Also was tun? –
Ich ging zu einem Placeur für Hotelangestellte.
Nach ein paar Tagen wurde ich zwei Damen vorgestellt. Mein von Paris
vorausgeschicktes Gepäck war immer noch nicht angerückt. Trotzdem
wurde ich für tüchtig befunden und angestellt. Antritt in 10 Tagen
hiess es. Es wurde dem Placeur verboten, mir die Adresse vor dem
Eintrittstage mitzuteilen, indem vermieden werden musste, dass ich etwa mit
meinem Schweizer Vorgänger in jenem Hotel Rücksprache nehmen
konnte.
So gab mir am Abreisetag der Placeur ein Bahnbillett mit der Weisung mit dem
12-Uhr-Zug ab Waterloo-Station abzufahren.
Ich hatte keine Zeit, um festzustellen, wohin die Reise ging, die Station
mit dem Billett war mir völlig unbekannt. Es langte kaum noch, um mit
einem «Cab» (zweirädriger Stadtverkehrswagen) mit Kutschner
hinten hoch über dem Verdeck) zur Bahn zu fahren.
Waterloo-Station. Einsteigen! Fort ging’s. Wohin?
Eine Nachfrage
bei einem Eisenbahnbeamten verlief resultatlos, weil er mich nicht verstand
und ich ihn noch weniger.
Die Mitreisenden waren stockenglisch. Was tun? Ich hatte meinen Reisekorb
mit Adresse zur taxfreien Beförderung aufgegeben, wie es damals
üblich war. Da kam mir der rettende Gedanke sehr rasch. Ich brauchte ja
nur aufzupassen, wo der Reisekorb hinging! Mit meinen wenigen Yes and No war
nicht weit zu kommen. If you please! Ich setzte mich dementsprechend
zunächst dem Packwagen in ein Coupé und harrte der Dinge, die da
kommen sollten.
Stundenlang ging die Fahrt, zur Stadt hinaus in die Landschaft von
Grossbritannien. Nach zwei Stunden kam eine Stadt, wo fast alle Passagiere
ausstiegen; mein Reisekorb blieb im Gepäckwagen. So ging’s
weitere zwei Stunden oder noch mehr bis Portsmouth-Stadt, wo wieder fast
alles ausstieg. Mein Reisekorb rührte sich nicht vom Fleck.
Unterdessen war es Nacht geworden, es regnete, wie leicht begreiflich
anfangs November. Der Zug rollte wieder fort in die Nacht hinaus bis
Portsmouth-Harbor (Hafen). Dort wurde der Korb beim Ohr gefasst und auf
einen Dampfer geschleppt. Ich auf und nach. Dann kam eine ungefähr
stündige Schiffahrt mit ziemlich bedenklichem Geschaukel, bis Ryde auf
Isle of Wight, wo wieder auf einen Zug umgestiegen werden musste. Noch war
das Ende der Fahrt, Cowes, nicht erreicht. Auf der Mitte der Insel kreuzen
sich zwei Eisenbahnlinien. In Newport musste neuerdings umgestiegen werden.
Um 9 Uhr abends kam ich wohlbehalten in Cowes auf Isle of Wight an. Ein Mann
erwartete mich und geleitete mich ins Hotel «Gloster», am Meer
gelegen. Heureka!
Hotelportier! Das will soviel sagen wie Hausknecht, der gelegentlich seinen
Portier-Kittel anzieht. Da hiess es sich dreinschicken. Setzerstolz war
schlecht am Platz. Was man tun muss, muss man gern tun. Ein schwerer
Grundsatz, an dem viele stolpern.
Das «Gloster»-Hotel war fast erstklassiger Art mit schöner,
grosser Terrasse direkt an der Sandstrasse am Meer. Zirka 30 Zimmer. Im
Winter gab es wenig Gäste mit Ausnahme bei Anlässen im Schloss der
Königin Viktoria von England, nahe bei Cowes. Ich konnte mich daran
machen, meine Kenntnisse der englischen Sprache zu erweitern. Natürlich
nicht nur in Gesprächen, sondern durch Lesen von Büchern,
Zeitschriften, Grammatik, Übersetzungen usw. Gleich ging ich hinter das
englische Buch «The flying Dutchman».
Beinahe ein Jahr blieb ich im «Gloster»-Hotel. Es gefiel mir gar
nicht schlecht. Bereits hatte ich daran gedacht, wieder nach London
zurückzukehren, um meine Tätigkeit im Berufe wieder aufzunehmen.
Eines Tages kam ein Brief meines Lehrprinzipals Fischer aus Münsingen,
der mich beauftragte, nach Berlin zu fahren und einen dreimonatigen Kurs in
der Fabrik zur Erlernung der Setzmaschinenarbeit an der Linotype zu
absolvieren. Das war eine hochwillkommene Nachricht. Alle Kosten wurden von
Herrn Fischer übernommen.
Mein Wegzug im «Gloster»-Hotel wurde von Mrs. Gordon bedauert.
Sie bewies mir ihre Zufriedenheit durch ein gutes Zeugnis. Über
Southhampthon, Calais, durch die Nordsee nach Bremen fuhr ich nach Berlin,
die dritte grosse Weltstadt, die ich auf meiner Auslandsreise zu besichtigen
Gelegenheit bekam. Eine andere Luft war in dieser Stadt bald zu fühlen.
In der Zeit meines Aufenthaltes hatte ich Gelegenheit, in Berlin eine grosse
Militärparade auf dem Tempelhofer Feld zu beobachten. Truppen von
90’000 Mann aller Waffengattungen wurden in grossen Defilees von
Kaiser Wilhelm mit seinen vielen Generälen paradiert. Grossartige
Schaustellungen fanden statt. Für einen demokratischen Schweizer
Soldaten kein erhebendes Schaustück, da es eher Bedenken erregte.
Nach drei Monaten Schulung in der Fabrik der Linotype-Setzmaschine
ging’s wieder der Heimat zu. 18 Stunden Fahrt 4. Klasse von Berlin bis
Frankfurt am Main. Diese besassen nicht einmal die gewohnte Bestuhlung,
sondern nur Bänke den Wänden entlang. In der Mitte wurden die
Koffer und Ballen aufgestellt, so dass sie als Sitzgelegenheit benutzt
werden konnten. Der Rest der Passagiere musste stehend den Schwankungen des
Zuges sich anpassen. Die vierte Klasse wurde aber viel benutzt, aus dem
einfachen Grunde, weil sie nur die Hälfte der dritten Klasse kostete.
Von Frankfurt an gab es dann wieder die beliebte schweizerische Wagenklasse.
Nach gut zweijähriger Abwesenheit6 ging es in Basel in glücklicher Erwartung
über die Grenze ins schöne Schweizerland mit seinen
unvergleichlichen Alpenländern. In Münsingen erwartete mich
freudiger Empfang meiner Familienangehörigen sowie meiner früheren
Kollegen in der Buchdruckerei Fischer. Dabei gab mir das kommende Wirken an
der «Linotype» einen erfreulichen Hintergrund.
Fast tags darauf begann schon das Auspacken der Setzmaschine vor den
Fenstern der Setzerei. Vier Handsetzern war bereits die Kündigung
zugekommen und diese sahen meiner Tätigkeit unangenehm betroffen zu.
Zwei Jahre vorher hatten wir in der Setzerei noch darüber gelacht, dass
die Schriftsetzerei mit einer Maschine ausgeführt werden könne.
In der Folge zeigte es sich bald, dass die Setzmaschine für die
Angestellten der Setzerei keine Gefahr mit sich brachte, sondern eine
wesentliche Förderung des Berufes. Die Zeitungen kamen in die Lage,
ihre Ausgaben bedeutend zu verbessern und zu vergrössern.
Die Tätigkeit an der «Linotype» in Münsingen
verbesserte mein Ansehen bei meinen vielen Freunden und Bekannten, und
besonders bei meinen Vettern und Basen und Verwandten. Fischer hatte Freude
an der Leistungsfähigkeit der Maschine. Während drei Jahren7 hatte ich nie die Hilfe eines
Monteurs notwendig, obschon diese Maschine noch lange nicht die
Vollkommenheit aufwies, wie dies in den späteren Jahren der Fall war. Viele Buchdruckereien folgten langsam dem Beispiel Fischers, das Furore
machte.
Im zweiten Jahre meiner Maschinensetzertätigkeit in Münsingen kam
es zu einem besonderen Intermezzo.
In der Sektion Thun des Schweizerischen Typographenbundes erfuhr ich mein
erstes gewerkschaftliches Erlebnis in einer Lohnbewegung. An einer Sitzung
der Typographia, der auch Münsingen angehörte, wurde beschlossen,
eine Lohnerhöhung um Fr. 2.– pro Woche zu verlangen. Alle
Mitglieder wurden verpflichtet, an dieser Forderung unbedingt festzuhalten.
In der Folge erklärten die Thuner Prinzipale, der Erhöhung um den
kleinen Betrag von Fr. 2.– zuzustimmen unter der Bedingung, dass auch
B. Fischer in Münsingen den Aufschlag annehme. Fischer aber
erklärte, er zahle rechte Löhne und lasse sich nicht zwingen! In
seiner Druckerei erschienen damals die «Emmenthaler
Nachrichten», wie heute noch, welche Zeitung ich damals auf der
«Linotype» allein setzte, soweit Text in Frage stand. Nun kam
Fischer dreimal zu mir in die Wohnung und verlangte von mir die
Erklärung, dass ich nicht streike, wenn es zum Streik kommen sollte.
Ich erklärte bei den zwei ersten Besuchen, dass ich an den
Typographiabeschluss verpflichtet sei und daran festhalten müsse. Dabei
berief sich Fischer auf seine Leistungen mir gegenüber. Ich hatte aber
das Bewusstsein, ich hätte in den 6 Jahren mehr für ihn geleistet.
Beim dritten Besuch erklärte ich ihm, dass ich nicht streike, aber in
vierzehn Tagen sei meine Arbeit bei ihm zu Ende. Zwei Tage darauf lud er die
Typographiamitglieder zu einem Zobig ein und bewilligte die
Lohnerhöhung, wie ich mir gedacht hatte. So wurde der Streik vermieden.
Es fehlte eigentlich nicht viel, so wäre ich in Münsingen meiner
Lebtag hängen geblieben. Aber die Gelegenheit bot sich, noch einmal
eine Fahrt in die Welt hinaus zu unternehmen. Ich war ja noch jung!
Wieder ging’s nach London8,
doch diesmal mit einer Anstellung in der Tasche. In London machte ich noch
einen Englisch-Kurs durch. In 17 Lektionen arbeitete ich die grosse
Grammatik durch und erwarb mir ein Zeugnis als guter Englisch-Schüler.
Schon in Cowes auf der Isle of Wight, bewunderten wir immer die grossen
Amerika-Dampfer des Northgerman-Lloyd, die gar nicht weit vor dem
«Gloster»-Hotel vorbeifuhren, nach Southhampton hinein, nachts
wunderbar beleuchtet, mit Musik an Bord. Nun in London hiess es für
mich: Auf nach Amerika, so bald als möglich!
Es musste «nur» das nötige Reisegeld gespart werden sowie
250 Franken, die man vorweisen musste bei der Einwanderung, um nicht der
Wohltätigkeit zur Last zu fallen. Arbeitereinfuhr war streng verboten;
man risikierte, franko zurückspediert zu werden. Nun mussten 50 Prozent
meines Wochenlohnes, 1 Pfund, unweigerlich in meine Reisekasse fliessen.
Nach einem halben Jahr war ich so weit. Mitten im stürmischen
Novemberwetter9 fuhr ich auf dem
«St-Louis», einem älterem Kasten, nach Amerika. Das
Geschaukel infolge des schlechten Wetters war so stark, dass es mir
während der ganzen Überfahrt den Appetit verdarb. Zur eigentlichen
Seekrankheit mit Erbrechen kam es bei mir nicht, hauptsächlich weil man
auf diesem Schiff ringsherum zirkulieren konnte. Auf einem grossen Teil der
Fahrt kamen im starken Wellengang immer die Schrauben hinten aus dem Wasser,
gerieten in schnelleren Gang und prallten beim Eintauchen mit harten
Schlägen wieder ins Wasser. Dabei gingen zwei Flügel der Schrauben
entzwei, so dass die Fahrt des Dampfers um 2½Tage verlängert
wurde und mit so viel Verspätung in Neuyork eintraf.
Der Empfang und die Behandlung auf Ellis Eiland bei den
Kontrollbehörden ging gut vonstatten. Ich konnte dem Kontrolleur in
drei Sprachen antworten.
Dank meiner gewerkschaftlichen Organisation bekam ich in Neuyork bald
Anschluss an den typographischen Verband. Auf dem Arbeitslosenbureau wurde
mir nach ein paar Tagen Aushilfskondition zugewiesen. Nach ein paar Wochen
wurde ein Linotype-Setzer verlangt, der die Fähigkeit haben musste,
englische Inserate deutsch abzusetzen. Das passte für mich; kein
anderer Anwesender konnte mir Konkurrenz machen. In der Buchdruckerei der
«New Jersey Freien Zeitung» in Newark bei Neuyork arbeitete ich
darauf zwei Jahre10 als
Linotype-Annoncensetzer.
Im Jahre 1904 wurde in St. Louis im Mississippital im südlichen Teil der Vereinigten Staaten eine Weltausstellung abgehalten, an der ich teilnehmen konnte. 20 Dollar machte die Reise hin und zurück, und zwar über die nördliche Route mit ihren Kohlenfeldern, die Niagarafälle, die grossen Seen, dann über die riesigen Mais- und Weizenfelder bis an den Mississippi hinunter. Die Coach-Extrazüge enthielten nach allen Richtungen verstellbare Sitze, die sich auch als Schlafstellen benutzen liessen mit ihren Plüschsitzen. Restaurationswagen fehlten nicht mit viel Musik, worunter die immer wiederkehrende Melodie «Meet me at St. Louis, Louis, meet me at the Fair». Durch die Maisfelder mit ihren niedrigen Pflanzen sauste der Zug stunden- und stundenlang ohne Halt dahin, fast immer eine Staubwolke hinter sich herschleppend. Am andern Mittag ging es auf sehr hoher Brücke über den Vater der Ströme nach St. Louis hinein. In der Ausstellung handelte es sich ganz besonders um die Produkte der Vereinigten Staaten und um die Geschichte der Landesentwicklung aus den Indianerzeiten herauf. Eine besondere Attraktion bot die Philippinenausstellung in voller Natürlichkeit. Ich erinnere mich besonders an die Vielfarbigkeit der Bevölkerung von ganz schwarz, braun bis weiss und an die grosse Hitze, die fast nicht auszuhalten war. Im ganzen eine Ausstellung aller menschlicher Errungenschaften bis zu diesem Zeitpunkt. Das Land der Bubenträume und Indianergeschichten.
*
In den ersten Tagen in Neuyork wollten mich zwei Gauner erwischen. Als ich
vormittags zur Arbeit ging, noch mit meinen Schweizer Kleidern angetan, die
mich als «Grünen» anprangerten, trat plötzlich ein
hinter mir Gehender vor mich hin, hob etwas vom Boden auf, das scheinbar von
einem weiter vornen gehenden Mann verloren worden war. Dann zeigte mir der
Mann in der hohlen Hand eine Banknote. Dazu machte er eine Bemerkung:
Gefundenes Geld ist herrenloses Gut; ich solle mit ihm in die Nebengasse
folgen. Dort zeigte er mir seinen «Fund». Es war eine
Hundert-Dollar-Note und eine 1-Dollar-Note. Dann schlug er mir gleich vor,
das Geld zu teilen, ich solle ihm 50 Dollar herausgeben. Das war mir
schlechterdings ganz unmöglich. Dann wollte er wissen, wie viel Geld
ich bei mir habe. Das machte mich stutzig. Lebhafte Diskussion beiderseits.
Zuletzt schlug ich ihm vor, er solle mir die 1-Dollar-Note geben und er
könne die 100 Dollar behalten. Das wollte er aber nicht. Dabei wurde
mir ganz klar, dass die hundert Dollar falsch waren, obschon ich keine
Ahnung hatte, dass es solche gab. Die Dollarnote war echt. Das war das Ende
des Spukes.
Eines Abends hatte ich in einer Grossdruckerei (es gab solche mit 40
Linotype-Setzmaschinen, wie die «Neuyorker Staatszeitung») eine
Nachtschicht zu absolvieren. Nachdem ich die Maschine gleich anfangs
misstrauisch betrachtet hatte, begann ich zu setzen. Beim Absenden der
ersten Zeile zum Guss vollführte die Maschine einen derartigen Krach,
dass ich entsetzt aufsprang und einen Kollegen fragte, was mit der Maschine
los sei. Er erklärte mir, das sei eine von den ersten Linos und hapere
viel. Dann setzte er einige Zeilen an der Maschine, ich wurde mit der
krachmachenden Maschine vertrauter. Es ging leidlich, aber nicht gut.
Kaum drei Wochen in Neuyork und glücklich, eine aussichtsreiche Stelle
gefunden zu haben, wollte ich nach Newark fahren, um meine Stelle
anzutreten. Ich hatte mein Zimmer im Hotel abbestellt. Im Laufe des Tages
stellte sich heraus, dass ich nochmals in Neuyork übernachten musste.
Mein Zimmer war jedoch besetzt und man gab mir irgendein freies Zimmer in
dem 20 Stock hohen Bau. Ich begab mich ins Zimmer und machte mich bereit, zu
Bette zu gehen. Während ich vor dem Bette die Schuhe auflöste,
bemerkte ich unter dem Bette eine aufgerollte Wolldecke. Ich machte schon
eine Bewegung, um nach der Wolldecke zu greifen, da dachte ich, ach was,
sicher hat das Zimmermädchen Wäsche in der Wolldecke versorgt.
Morgen um 6 Uhr beim Aufwachen waren zu meinem Schrecken meine Kleider im
ganzen Zimmer verstreut. Es fehlte meine Mantel, es fehlte mein Portemonnaie
und noch anderes. Glücklicherweise war der Dieb ein
«Grüner», sonst hätte er meine Noten und mein Zahltag
gefunden und nicht nur das Portemonnaie mit etwas Münz. Die Amerikaner
trugen damals fast alle das Münz in einem kleinen Täschchen am
Rock, die Noten in einem Notentäschchen. Die Wolldecke unter dem Bett
lag nun flach da. Vom Dieb war natürlich nichts mehr zu finden. Was
hätte passieren können, wenn ich die Wolldecke aufgemacht
hätte?
In Newark arbeitete ich an der «New Jersey Freien Zeitung» als
Inseratesetzer und Übersetzer zugleich, wobei mir
Linotype-Setzmaschinen zur Verfügung standen. 6 weitere Setzmaschinen
dienten in zwei Schichten zur Herstellung des Textes der Zeitung. Ein
Linotype-Mechaniker und -Fachmann besorgte alle auftretenden Störungen
an den Setzmaschinen, so dass die Operateure nur zu tippen brauchten. 1000
Zeilen mussten in einer Nacht von jedem geleistet werden. Jede Maschine
besass einen Zeilenzähler. Als Beleuchtung waren elektrische Birnen
alten Systems vorhanden, man nannte sie Glühwürmer. Osram-Lampen
mit dem viel besseren Licht gab es damals noch nicht. In der
Inserateabteilung erhielten wir grosse Geschäftsinserate zum Setzen,
die von den Auftraggebern einfach aus den englischen Zeitungen
herausgeschnitten waren. Das Übersetzen wurde von den Setzern besorgt,
teils Maschinensatz, teils Handsatz. Bei dem Übersetzen kam die
Eigentümlichkeit zum Vorschein, dass man nicht zu sehr nach gutem
Deutsch übersetzen durfte, sondern man musste sich an das
Gebrauchsdeutsch halten, wie es sich mit Englisch gemischt eingelebt hatte.
Es war nicht sehr schwierig, sich diesem Mischmasch anzupassen. Im Sommer
war es oft fast unerträglich heiss. In der Druckerei hatten wir
über 100 Grad Fahrenheit Temperaturen (zirka 38 Grad Celsius). –
Mit allen Setzern und Druckereiangestellten stand ich die zwei Jahre
hindurch in bestem Einvernehmen.
In den ersten Monaten wohnte ich in Newark in einer Zimmermieterei nicht zu
weit von der Druckerei. Eines Morgens, um 2 Uhr, kam ich von der
Nachtschicht heim. Zu meinem Schrecken fand ich meinen Hausschlüssel
nicht in meinen Taschen. Ich läutete mehrmals an der Haustür;
niemand machte mir auf. Mein Zimmer lag im ersten Stock hinten hinaus. Was
tun? Neben dem Haus war eine Bretterwand, fast zwei Meter hoch. Ich
kletterte mit Mühe über die Wand. Leider fand sich auf der andern
Seite ein Stapel von leeren Blechfässern und Kannen, die natürlich
in Bewegung gerieten und einen grossen Lärm verursachten.
Glücklicherweise rührte sich niemand im Haus. Im Hof musste ich
nun ein Vordach erklettern, das aus Wellblech bestand, um zu meinem Fenster
zu gelangen. Während ich auf dem Dach emporkroch, das Blech machte
ordentlich Geräusch, kam mir in den Sinn, dass mein Zimmerkamerad, den
ich kaum kannte, einen Revolver im Nachttisch aufbewahrte. Ein paar Minuten
hatte ich wirklich Angst, der Mann könnte mich, den vermeintlichen
Einbrecher, mit dem Revolver «begrüssen». Aber nichts
geschah. Er schlief ruhig weiter. Er arbeitete tags, so dass ich ihn kaum
sah und nachts war ich meist abwesend an meiner Arbeit.
In Newark ward ich ohne weiteres in die deutsche Typographia Nr. 8
aufgenommen. Der Präsident war zudem noch Schweizer namens Ferdinand
Meyer, der mich mit kordialem Handschlag begrüsste an der
Mitgliederversammlung. 52 Jahre sind seither verflossen und immer noch stehe
ich mit diesem früheren Kollegen in ständiger Verbindung. Er ist
heute (1955) 84 Jahre alt. Sein Bild hängt in meiner Stube. Vor
fünf Jahren war er 14 Tage bei mir «z’Visite». Einen
tapferen Sohn hat er im Zweiten Weltkrieg im Pazifik verloren. Ein anderer
Sohn ist amerikanischer Oberst und tat zwei Jahre Dienst mit der USA-Armee
in Deutschland. Meyer ist seit vielen Jahren als Beamter im graphischen
Gewerkschaftswesen tätig und als Delegierter an vielen Kongressen.
Soeben schrieb er mir mit Datum vom 3. Juli 1955, er hoffe auf ein
Wiedersehen im nächsten Jahr. Cheerio! Geschäfte gut! Löhne
hoch!
Die zwei Jahre habe ich fleissig zu meiner Ausbildung benützt. Wenn ich
heute daran zurückdenke, hätte ich mich nicht so sehr auf meinen
Beruf versteifen sollen, sondern auf weitergehende Ziele. Da ich Nachtarbeit
hatte, war es mir möglich, drei Monate lang eine Geschäftsschule
zu besuchen. In der Druckerei hatte ich Nachtschicht bis morgens um zwei
Uhr, ging um 8 Uhr morgens in die Schule, in eine englische natürlich.
In drei Monaten habe ich mir unter anderem eine recht gute Handschrift
aneignen können, was mir in den 9 Jahren in der Schweiz lange nicht so
gut gelang. Amerikanische glänzende Methode! Auch photographische und
illustrative Kenntnisse machte ich mir zu eigen, letztere mit Hilfe eines
Fern-Schulkurses im Zeichnen und Skizzieren. Der «Erfolg» dieser
Arbeitsweise hatte Kurzsichtigkeit zur Folge. Die erste Brille musste her.
Beim Abschied aus der Druckerei der «New Jersey Freien Zeitung»
in Newark versprach man mir, meine Stelle für mich noch 6 Monate offen
zu halten. Ich konnte mich damals noch nicht dazu entschliessen, von meiner
Heimat und meinen Angehörigen, Mutter und Geschwister sowie zahlreiche
weitere Verwandte, für dauernd Abschied zu nehmen. Ich wollte noch
einmal zurück, um zu sehen, ob ich zu Hause mir eine Existenz
verschaffen könnte, nach 5jähriger Gesamtabwesenheit.
Auf der Heimreise von New York mit dem grossen 32’000-Tonnen Dampfer
«Kaiser Wilhelm der Grosse» verlebten wir mitten im Monat
August, wo sonst das Meer dank schönstem Wetter am ruhigsten ist, einen
gewaltigen Sturm, einen amerikanischen Taifun. Damals gab es auf den
Ozean-Dampfern das berüchtigte sogenannte Zwischendeck, bestimmt in
erster Linie für die Auswanderer, die mit äusserst knappen Mitteln
zu rechnen hatten und öfters gratis befördert werden mussten. Am
dritten Tag unserer Fahrt ab New York begann sich am Horizont eine graue
Wand aufzubauen. Vorsorglicherweise hatte ich bei der Ankunft an Bord des
stolzen Schiffes Verbindung mit einem Angestellten des Schiffes aufgenommen,
um eine Matrosenkabine zu bekommen. Gegen eine bescheidene
Extravergütung wurde mir und drei Kameraden auf dem vorderen Teil des
Schiffes eine vierplätzige Matrosenkabine überlassen. Bei
schönem Wetter hielten sich die Zwischendeck-Passagiere auf dem
Vorderteil des Schiffes auf. Dort konnten Delphine beobachtet werden, die in
Gruppen von drei oder vier aus dem Meer auftauchten und wieder ins Wasser
zurückplumpsten. Vor dem Spitz des Schiffes gab es auch zuweilen
Schwärme von fliegenden Fischen zu sehen. Auf dem vordersten Teil
befanden sich Ankereinrichtungen, Wellenbrecherwände von zirka 80 cm
Höhe, Luftfänger, welche für frische Luft in den untern
Räumen sorgten und allerlei anderes mehr. Dazwischen verstauten sich
Zwischendeckpassagiere und erfreuten sich an den Ereignissen an Bord. Nach
diesem grossem Schiffsteil, dem Bug, folgte eine Etage tiefer ein grosser
offener Raum quer über den Vorderteil. Hier vertrieben sich die
Passagiere in allen möglichen Sprachen die Zeit. Zu meiner
Überraschung zog ein ganz einfacher Arbeiter neben mir eine
prächtige goldige Uhr aus der Tasche. Dies zum Beweis, dass Arbeiter
wie ich auch, die billigste Beförderungsart wählten um ihre
Ersparnisse zu schonen.
Nun begann das Schiff einen stärkeren Wellengang zu spüren. Die
graue Wand am Horizont stieg höher und höher. Der Wind nahm zu.
Matrosen erschienen und beorderten die Passagiere in ihre Aufenthalts- und
Schlafräume. Ventilations- und Luftfänger wurden wegmontiert.
Mehrere Passagiere und ich auch legten uns hinter die eisernen
Wellenbrecherwände und genossen das sich bietende Schauspiel. Die
Wellen wurden immer höher, der Sturm begann zu toben. Das Schiff fuhr
diagonal durch die Wellen, wobei der Vorderteil sich immer tiefer in die
Wellen einbohrte. Dabei begannen bei jedem Eintauchen in den Wellenberg
stets stärkere Spritzer bis hoch an die Aufbauten des Dampfers
aufzujagen. Anfänglich kamen oben Erstklass-Passagiere dem
Geländer entlang, um das Schauspiel zu geniessen. Dann kam ein
grösserer Spritzer und verjagte die aufschreienden Damen, was uns
hinter den Wellenbrechern viel Spass machte. Nun aber beorderten uns
Matrosen, schleunigst unsere Schutzstellen zu räumen, ansonst wir wie
Ratten ertränkt werden würden. Es war höchste Zeit zu
fliehen. Bald tauchte der Vorderteil des Schiffes ganz in die Wellenberge
hinein. Der Dampfer, der öfters ganz auf einer Seite einer Welle Platz
fand, tanzte richtig nach allen vier Richtungen. Nun schlugen die Wellen in
Wasserbergen über den Vorderteil herein und in den Zwischenraum, worauf
das Wasser seitlich ablaufen konnte. Die ungeheuren Wasserkräfte waren
am Werk, konnten aber dem starken Schiff nicht viel anhaben. Das Krachen der
riesigen Wellen in dem vorderen Zwischenraum war beängstigend.
Unterdessen hatten wir uns in der Viererkabine schon seekrank niedergelegt.
Das anhaltende Versinken am Bug, gut 8 m tief, und wieder Aufsteigen, einmal
linksschräg, dann rechtsschräg, zwang die Eingeweide zur
Rebellion. Da gabs kein Mittel dagegen. Der Magen musste ausgeräumt
werden, und als nichts mehr drin war, wollte der Magen selbst Abschied
nehmen. So schien es mir und meinen Kabinengenossen. – Draussen im
Korridor ging plötzlich ein anderes Donnergepolter los. Zuvorderst im
Korridor waren viele leere Kessel, Kisten usw. verstaut gewesen,
wahrscheinlich schon mehrere Monate, ohne sich zu rühren. Nun tanzte
das Zeug im Korridor hin und her, längere Zeit. Zwei volle Stunden
dauerte der grausige Sturm, hatte in den Sälen allerhand Unheil
angerichtet, zwei Matrosen derart an eine Wand geschleudert, dass sie Arme
und Beine brachen. Dann war die Gewalt des Orkans gebrochen. Die Fahrt wurde
ruhiger. Mit dem Sturm ging auch die Seekrankheit vorbei.
Dann wagte ich einen Spaziergang in das Quartier des Zwischendecks tiefer
unten. Die Angestellten waren schon dabei, den grossen Raum, der über
die ganze Breite des Schiffes ging, mit Wasserströmen zu reinigen unter
allen Betten hindurch. Die Betten und Bettreihen, aus einfachen
Metallgestellen bestehend, immer zwei Betten übereinander, waren nachts
einfach aneinander geschoben, so dass viele Passagiere über zwei andere
Betten hinwegkriechen mussten, um ihre Bettstelle zu erreichen. Nun stelle
man sich den Zustand während des Sturmes vor, wo alle Bullaugenfenster
hermetisch geschlossen waren und alle mit den Magenausbrüchen in ihre
Behälter zu kämpfen hatten, in einer Luft zum Abschneiden. Es war
ein unvergesslicher Erlebnis! Die Zwischendecks wurden Jahre später
ganz umgebaut in die sogenannte Touristenklasse mit besseren Zuständen.
Der Rest der Fahrt bis Cherbourg verlief wieder in bester Weise. Fast alle
hatten sich erholt.
* * *
Aus Amerika habe ich 5000 gute Schweizerfranken als Ersparnisse meiner Arbeit heimgebracht, bestimmt, mir zu helfen bei der Gründung einer Existenz. Da fand ich in Münsingen eine kleine Notiz betreffend einer Stelle für einen Buchdrucker zur Gründung einer Zeitung. Ich fuhr nach Bern zur Erforschung dieser Sache und dann nach Olten. Am gleichen Tage besuchte in Münsingen ein Polizist meine Wohnung in meiner Abwesenheit. Es handelte sich um eine Dienstsache. Ich war Ende August so rechtzeitig heimgekommen, nach fünfjähriger Gesamtabwesenheit im Ausland, um meine Dienstpflicht in einem Truppenzusammenzug zu erfüllen. Im Frühjahr, zur Zeit der Inspektion der Militäreffekten, war ich in Amerika. Die Kleider und Waffen lagen wohlversorgt in Langnau im Zeughaus; mein Urlaub war in Ordnung. Nun hiess es, ich habe die Inspektion versäumt und auch die Nachinspektion im Herbst. Ergo habe ich drei Tage Strafschiessdienst zu absolvieren! Meine Reklamation beim Kreiskommando in Bern trug mir die Bemerkung ein, da ich reklamiert habe, müsse ich die drei Tage in Bern doch erledigen! So belohnt man einen diensteifrigen Korporal, wenn er glaubt, seine Pflicht voll und ganz erfüllt zu haben!
Nun begannen im Herbst 1904 die Verhandlungen über die Gründung
einer sozialdemokratischen Zeitung. Diese dauerten bis ins neue Jahr 1905
hinein. Die Gründung einer solchen Zeitung in Olten wäre mir
unmöglich vorgekommen, wenn nicht die Setzmaschine die Möglichkeit
geboten hätte, die Sache zu wagen.
Weder in Olten noch in Solothurn oder Aarau war eine «Linotype»
vorhanden. Sie bot mir einen wichtigen Vorsprung. Mit Hilfe der Maschine
konnte ich mit wenig Personal eine Zeitung mit grossen Formates
herausbringen und den ganzen Text des Blattes und der Unterhaltungsbeilage
selber setzen und dabei wesentliche Redaktionsarbeit leisten. Eine
«Linotype» musste also her, wenn die Sache gelingen sollte.
Zu meinen 5000 Franken brauchte ich noch mindestens einen Kredit von
23’000 Franken zur Anschaffung einer Setzmaschine und einer
Schnellpresse sowie des Setzerei-Inventars. Wo die Bürgen für
einen solchen Kredit hernehmen?
In Olten glaubte man noch gar nicht daran, dass es mir gelingen werde, das
Projekt zu realisieren. An den Verhandlungen beteiligten sich keine sehr
vermöglichen Genossen, die in der Lage gewesen wären, eine solche
Bürgschaft zu übernehmen. Es war gewagt, Freunde oder Bekannte
für ein solches Projekt anzugehen. Ich hoffte zuversichtlich, die
Schuld auch wieder rechtzeitig zurückzahlen zu können. Das hatte
sich später bewahrheitet. Ich fand zwei Freunde unserer Familie, die
gewillt waren, mir zur Gründung einer Existenz zu helfen. Unser
freundlicher Nachbar in Herzogenbuchsee, F. H., sagte mir zu, ebenso mein
Onkel Hans Burri, Spenglermeister, in Aarwangen. Sie hatten Vertrauen zu
mir. Bei den damaligen Unterhandlungen wusste ich selbst noch nicht, in
welcher Form und Haltung sich die Zeitung gestalten lasse.
Es war ein Risiko und kein kleines. Das kann man jetzt noch beurteilen. Meine Schwester Flora11, junge Schullehrerin, erklärte sich bereit, mir zu helfen durch Übernahme der Büroarbeiten, Korrekturlesen usw. Mein Mutter übernahm die Besorgung der Haushaltung in der einfachen Wohnung im «Bären». Sie half tüchtig mit in der Druckerei Tag für Tag. Lohn war keiner zu erwarten bis die Gründung sich zu einem Erfolg durchgekämpft habe. Mein Bruder Ernst Trösch12 in Bern versprach mir seine Mithilfe. Sie waren die Hauptstützen innen und aussen und verdienen unsern herzlichen Dank und Anerkennung.
Die Oltner Zeitungen waren damals kleiner in Format und Umfang. Die «Neue Freie Zeitung» hatte ich als zweimal wöchentlich erscheinende Zeitung gedacht mit grossem Format und fünfspaltigem Text. Dazu ein selbst herauszugebendes Unterhaltungsblatt «Für die Feierstunde».
Es musste ein Blatt werden, das der Arbeiterfamilie das bietet, was sie von ihrem Blatt verlangt: Aufklärung und Kampf in sozialen Fragen, Nachrichten aus Heimat und Fremde, Artikel und Korrespondenzen über kantonale und schweizerische Fragen, Belehrung und Unterhaltung. Die Durchschnittsfamilie ist nicht für zu viele Kampfartikel, sondern für das, was die Familie interessiert, inbegriffen Wahrung des Standpunktes und der Interessen der Arbeiterschaft im Existenzkampf.
Meine Jugend hatte nichts mit dem Kampf der Arbeiterschaft zu tun. In Herzogenbuchsee herrschte eine eigene Politik, in welcher Uli Dürrenmatt mit seiner «Buchsi-Zitig» die wichtigste Rolle spielte. Dabei focht er auf konservativer Seite, war aber sehr angriffig gegen Willkür und Unrecht auf eidgenössischem und kantonalem Boden. Er war ein grosser Dichter, der für jede Nummer ein eigenes zügiges Gedicht neben dem Zeitungstitel herausbrachte. Sein Blatt erfuhr eine beträchtliche Verbreitung.
Meine Eltern, die auch unten hatten anfangen müssen, hatten ihren Existenzkampf durchzufechten und keine Zeit für Politik. Ich musste auf meine eigenen Erfahrungen und ganz auf diejenigen meines fünfjährigen Auslandsaufenthaltes abstellen. Als Typographia-Mitglied war ich schon in Organisation und Gewerkschaftskampf eingeführt. In Münsingen, Frankreich und in Amerika hatte ich bei Lohnforderungen mitzuwirken und ich war auch belesen in diesen Gebieten. Aus Amerika brachte ich eine Mappe voll interessanten Materials heim. In Amerika erlebte ich es, wie organisierte Arbeiter einen viermal grösseren Lohn verdienten als Nichtorganisierte. Diese letzteren litten Mangel in vielen Dingen. Gute Löhne sind die Grundlage zum vernünftigen Leben und auch zum guten Geschäftsgang in Stadt und Land.
Die Gewerkschaften haben viel zum Gedeihen von Handel und Wandel beigetragen und damit zur Hebung des Lebensniveaus des arbeitenden Volkes. In der Schweiz waren damals mehr Hungerlöhne als anständige Löhne üblich. Die Aufwärtsbewegung ging sehr langsam.
Dieses Beispiel in Amerika war sehr belehrend darüber, was Organisation und Zusammenhalten in den Gewerkschaften erreichen können. Kein Wunder, dass mir diese Lehre Eindruck machte und bewies, dass Aufklärung not tut, und zwar nicht nur bei der Arbeiterschaft, sondern auch bei andern Berufsgruppen und Bevölkerungskreisen. Es war nicht verwunderlich, dass mich die Oltner Buchdruckerei- und Zeitungsfrage sofort sehr interessierte. In dem schweizerischen Zentralpunkt Olten war gewiss eine Arbeiterzeitung ein Bedürfnis. Diese Meinung wurde aber bei der Arbeiterpresse in Bern und Zürich nicht geteilt. Sie sprachen von Zersplitterung, die aber schon von den Kantonsgrenzen herkam.
Die Arbeiterschaft des Kantons Solothurn begrüsste das Erscheinen einer neuen solothurnischen Arbeiter-Zeitung. Es war ein Ziel ernsthaften Schweisses wert. Nicht die Frage nach einem finanziellen Erfolg war das Ziel, sondern die Schaffung eines Werkes im Interesse der Schwachen gegenüber den meist rücksichtslosen Starken. Solche Ziele sind aber nur durch gute Organisation sowie durch sorgfältige Ausarbeitung der Pläne zur Besserung und zum Fortschritt erreichbar.
Man weiss es heute, wie rückständig 1905 die sozialen Bedingungen des Lebens in der Schweiz waren. Und wie viele falsche Auffassungen und Meinungen bestanden. Die Gründung einer Arbeiterzeitung war eine notwendige Sache, trotzdem wurde diese schwer bekämpft. Erst langsam erwies sich: Hat der Arbeiter Geld, so hat’s die ganze Welt! Der Arbeiter bleibt aber immer an einem gewissen knappen Existenzminimum hängen. Verteuerungen nehmen ihm einen guten Teil der Verbesserungen weg. Wohin käme man heute mit den Hungerlöhnen vom Anfang dieses Jahrhunderts? Dank ihrer Organisation waren die Typographen unter den am besten bezahlten Arbeitern.
An der Besserung des Lebensstandards der Arbeiter hatten auch andere Berufsgruppen ein Interesse und darum auch Sympathie für den Aufstiegskampf der Gewerkschafts- und Eisenbahnerverbände, und auch der Arbeiter-Zeitung.
Die Grösse der Aufgabe lockte mich, allen Gefahren zum Trotz sie in Angriff zu nehmen. Viele Hoffnungen galt es zu erfüllen, das Recht zu stützen, die Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Das Leben der Menschen ist erst lebenswert, wenn es vernünftig gestaltet werden kann. Der Arbeiter hat nicht nur die Pflicht, zu arbeiten, sondern auch das Recht zu einer guten Lebensgestaltung. Er muss mehr Zeit haben, um sich seiner Familie zu widmen und deren Leben glücklicher zu machen. Dazu braucht es Verbesserungen der Löhne, Verkürzung der Arbeitszeit von 10–11 Stunden in Fabrik und Werkstatt. Ferien waren damals ein unbekannter Luxus!
Um das Unternehmen zu einem Erfolg führen zu können, war vor allem ein reichhaltiges Blatt notwendig, das Aussicht bot, Leser und Abonnenten zu gewinnen. Das musste mit der Setzmaschine zu erreichen sein. Warum nicht eine solche Maschine in den Dienst der Arbeitersache zu stellen, um dem menschlichen Fortschritt zu dienen? Nur mit der Setzmaschine war die Möglichkeit vorhanden, dem Projekt die Grundlage zum Erfolg zu schaffen, in Verbindung mit rastloser Selbstarbeit an der Maschine, um grosse Kosten einsparen zu können.
Ein reichhaltiges Blatt musste Freunde werben, musste der Arbeiterschaft das bieten, was sie sich wünscht als Hauszeitung einer Familie. Bei den Oltner Arbeitern zeigte sich von Anfang an viel Arbeitswille zur Mithülfe sowie lebhafter Kampfgeist. Olten und Umgebung hatte schon Tausende von Arbeitern und Arbeiterinnen, die von einem Arbeiterblatt Unterstützung in ihrem Kampfe um die Existenz erhofften. Es war aber auch mit starker Gegnerschaft zu rechnen.
Aus dem Erzählten aus dieser Gründungsgeschichte ist zu ersehen, an wie vielen Klippen das Schiff heil vorbeikommen musste, um der Verwirklichung näher zu kommen.
Jeder Fachmann hätte mir abgeraten, ein solches Wagnis in Angriff zu nehmen!
Nach vielen Besprechungen mit den Oltner Initianten wurde die Situation klar
herausgearbeitet. Ich erklärte mich endlich bereit, auf mein Risiko die
Druckerei und die Zeitung zu gründen. Dem kommenden Blatt schlug ich
als Titel «Neue Freie Zeitung» vor, Zentralschweizerisches
Volksblatt, Organ der Sozialdemokratischen Partei von Olten und Umgebung und
der Arbeiterunion Aarau. Redaktion und Verlag von W. Trösch. Als
Druckerei-Lokal war das frühere Sattlereilokal der Familie Studer im
«Bären» gefunden worden. Beim Montieren der einfachen
Schnellpresse, der Setzmaschine und so weiter hatten es die umstehenden
Buben bald heraus: Das gibt jetzt die «Oltner Tagwacht»!
Am 12. April 1905 erschien Nr. 1 der «Neuen Freien Zeitung» Das Blatt wurde sofort freudig begrüsst und sicherte sich von Anfang an
viele Freunde. Präsident des Parteikomitees, Genosse Fürsprech
Kessler, schrieb den ersten Aufruf und Leitartikel. Die Eisenbahner der
Stadt Olten, die Arbeitervereine, die Grütlianer, die Gewerkschaften in
Stadt und Land wurden Freunde des Blattes und sahen einer Belebung der
ganzen Bewegung im Kanton und in den Nachbargebieten entgegen. Überall
zeigten sich tätige Freunde im Sammeln von Abonnenten. Zahlreiche
Mitarbeiter in Stadt und Land fanden sich. Der tätigste von allen war
gewiss der Eisenbahner August Kamber, samt seinen Familienangehörigen,
worunter der nachmalige Oltner Rektor Dr. Kamber.
In der Druckerei war sehr fleissige Arbeit notwendig, um möglichst
rasch aus den Kosten der Neugründung hinaus zu kommen. Die
Maschinenmeisterfunktion musste ich selbst übernehmen, Arbeiten, die
ich gewohnt war von meiner Lehre her. Meine Schwester, damals junge
Lehrerin, besorgte das Bureau, Korrekturenlesen. Meine Mutter, ihr Lebtag an
fleissiges Arbeiten mit langen Arbeitsstunden gewöhnt, arbeitete
unverdrossen angreifend und mithelfend in der Druckerei. Daneben besorgte
sie noch unsere Haushaltung in einem bescheidenen Logis im
«Bären». Sie verstand es in überraschender Weise, sich
in die soziale Bewegung einzupassen.
Aus einer andern Druckerei kam ein Lehrling zu mir und wünschte, seine
Lehrzeit bei mir zu vollenden, da er zu wenig Gelegenheit habe, etwas
Rechtes zu lernen. Dieser Jüngling hiess Otto Nickler, der sich
später zu einem hervorragenden Linotypesetzer entwickelte. Die
Setzmaschine zog ihn an, und offenbar auch die neuen Ideen. Nickler besass
auch bemerkenswerte dichterische Qualitäten. Zu meinem ersten und
langjährigen Hilfsarbeiter entwickelte sich Fritz Leu, der heute ein
Alter von beinahe 90 Jahren erreicht hat, stets treu und zuverlässig,
tatkräftig unterstützt von seiner Frau, die beide eine ehrenhafte
Erwähnung reichlich verdient haben.
Bald verschwand in den Leserkreisen die Furcht, das Blatt könne sich
nicht halten. Es ging aufwärts.
Als Mitarbeiter in der «Neuen Freien» betätigte sich auch
mein jüngerer Bruder Ernst, damals Gymnasiallehrer in Bern. Ernst Nobs,
nachmaliger Bundesrat und Seminarfreund meines Bruders, hat in einem Artikel
«Oltner Erinnerungen» von meinem Bruder und unserer Familie in
freundlicher Weise berichtet und auch von meinem Schwager Ernst Reinhard,
was mich ganz besonders gefreut hat. Die «Neue Freie» hat er in
seiner Tätigkeit als Lehrer nicht vergessen und später als
Lokalredaktor in Luzern im Hauptblatt mitgewirkt.
Bei der politischen Gegnerschaft im freisinnigen und konservativen Lager
wurde das neue Blatt begreiflicherweise nicht gerne gesehen. Über die
Kräfte des neuen Blattes wurden Auskünfte eingezogen, so dass der
Führer der freisinnigen Partei, Herr Dr. A. Christen, sich
äusserte: Trösch sei soweit recht, aber in zwei Jahren sei er
kaputt! (finanziell natürlich). Wenn er auch feststellte, dass kein
Reichtum vorhanden sei, so unterschätzte er offenbar die
Arbeitsleistung der Setzmaschine und den Unterstützungswillen der
Arbeiterschaft und der Mitarbeiter. Mit der Tätigkeit an der Linotype
wurde es möglich, mit wenig Personal eine grosse Zeitung herzustellen.
Eine kleine fortschrittliche Tat ereignete sich in Olten gleich während
der Einrichtung der Druckerei. Die Sektion Olten des Typographenbundes war
damals bestrebt, einen tariflichen Minimallohn zur Anerkennung zu bringen.
In Olten weigerten sich die Druckereien, diese Forderung anzuerkennen. Ich
erklärte aber sofort, diese Forderung zu unterstützen. Diese
Zustimmung bewirkte, dass die andern Druckereien ebenfalls eine dahingehende
Erklärung abgaben. Sie sagten sich wohl, wenn der Anfänger das
könne, so müssten sie von der Ablehung abstrahieren.
Genosse Josef Theiler, damals Präsident des Schweizerischen
Zugspersonalvereins, hat mir gleich im ersten Jahr und auch in den folgenden
Jahren den Jahresbericht zum Druck übergeben. Damals war auch Paul
Brand, früherer Pfarrer, Sekretär des Schweizerischen
Zugspersonalvereins. Eine Strasse im Fustlig ist nach seinem Namen benannt.
Die Propaganda für die Zeitung durfte nicht vernachlässigt werden.
Bei einem Wettbewerb im Abonnentensammeln setzte ich als ersten Preis mein
gutes Velo ein. Preisfrage: Wie viele Weizenkörner befinden sich in der
ausgestellten Flasche? Gute Arbeit wurde von den Wettbewerbern geleistet.
Die Auflage des Blattes wuchs.
Schon im ersten Jahrgang entwickelte sich Dr. A. Heim, Augenarzt, als
famoser und gern gelesener Artikelschreiber, der oft von der Gegnerpresse
zur Zielscheibe ihrer Angriffe gemacht wurde, was zu seiner Popularität
bei den Lesern der «Neuen Freien Zeitung» nicht wenig beitrug.
Mein Bruder Ernst Trösch lieferte zu einer Osternummer einen
längeren, fortschrittlichen Leitartikel, der von vielen gelobt und
begrüsst wurde. In den «Oltner Nachrichten», dem
katholischen Organ, stiess er aber auf starke Ablehnung. Dieser Artikel gab
noch lange Anlass zu Pro- und Kontra-Einsendungen.
Schon am Schluss des ersten Jahrganges, im Dezember 1905, konnte zur dreimal
wöchentlichen Ausgabe geschritten werden, gestützt auf lebhafte
Wünsche aus den Kreisen der Leserschaft und auf den Erfolg im ersten
Jahr. Das brachte eine weitere Förderung, hatte aber zur Folge, dass
das Unterhaltungsblatt «Für die Feierstunde» fallen
gelassen werden musste. Im ersten Halbjahr dieser dreimaligen Ausgabe gab es
an der Maschine viel Nachtarbeit, die meistens an mir hängen blieben
aus Ersparnisgründen.
Mit dem dritten Jahrgang machte sich eine neue Kraft bei den Mitarbeitern in
hervorragender Weise bemerkbar. Es war der E.-R.-Korrespondent, nachmaliger
schweizerischer Parteipräsident und bernischer Regierungsrat Ernst
Reinhard, damals Lehrer in Herzogenbuchsee. Er wurde später mein
Schwager. Viel zu früh, im Alter von erst 58 Jahren, musste er seine
grosse Tätigkeit einstellen und dem Tode seinen Tribut zollen.
Ähnlich erging es meinem Bruder Ernst Trösch in Bern, der im Alter
von 65 Jahren vom Tode dahingerafft wurde.
Viele Freunde, die bei der Gründung und später mitgeholfen haben,
mussten seither Abschied nehmen. Herzlichen Dank ihnen allen! Ehre ihrem
Andenken!
Eine besondere Ehrenmeldung haben die Lostorfer Genossen verdient für
ihre fleissige Unterstützung des Parteiblattes, voraus Hans
Brügger, Bitterli und andere. 1908 bei den ersten Kantonsratswahlen
hatten die Lostorfer Genossen die Mehrheit im Gemeinderat errungen und Hans
Brügger wurde zum Ammann gewählt.
Schon früh nach dem Erscheinen der dreimaligen Ausgabe wurde der Wunsch
in Parteikreisen laut, das Blatt täglich herauszugeben. Das war aber
vorerst noch eine unerreichbare Fata Morgana.
Mit dem dritten Jahr zeigte sich im «Bären» die
Notwendigkeit, grössere Räume zu beschaffen. Ohne die Lösung
dieser Vorfrage war eine tägliche Ausgabe undenkbar. Da musste schon
eine gute Portion Glück mir zur Hülfe kommen. Etwas später
fand sich dieses Glück in der eigenen Familie. Es gelang, den noch
freien Bauplatz an der Froburgstrasse zu erwerben. Das war eine
Erlösung aus grosser Not.
Mit dem Neubau konnte so rasch vorwärts geschritten werden, dass der
Neubau des Hinterhauses für die Druckerei im Herbst 1909 bezogen werden
konnte. Im Jahre darauf, 1910, wurde das Hauptgebäude, Froburgstrasse
9, bezugsbereit. Damit gab’s Platz genug für die damalige
Unternehmung.
Mit dem Näherrücken der täglichen Ausgabe kamen zahlreiche
Fragen und Möglichkeiten zur Behandlung. Das Jahr 1910 barg viele
Vorarbeiten in sich. Die Aargauer und Luzerner Genossen litten am Aufkommen
ihrer Zeitungen. Beide Parteien verfügten nur über kleine, zweimal
wöchentlich erscheinende Zeitungen. Mit dem Projekt der täglichen
Ausgabe der «Neuen Freien Zeitung» begrüsste ich die
Luzerner und Aargauer mit dem Vorschlag, ein gemeinsames Organ zu
gründen in der Form eines vierseitigen Hauptblattes für alle drei
Kantone. Dank der Vergrösserung der Auflage konnte ein relativ sehr
billiger Preis für die Luzerner und Aargauer Blätter ausgerechnet
werden. Diese beiden Organe erhielten etwas später lokale Beilagen zum
Hauptblatt, also sechs Seiten grossen Formates. Dadurch konnten die
Wünsche aller drei Pressunionen erfüllt und den Abonnenten ein
zügiges Blatt geliefert werden, Redaktion des Hauptblattes im Preise
inbegriffen.
Dieses Projekt wurde in glücklicher Weise gefördert von Genosse
Albisser, Präsident von schweizerischen Eisenbahner-Organisationen, in
dem er den Druck des «Flügelrades» zusicherte, um den Druck
des zentralschweizerischen Hauptblattes billiger gestalten zu können.
Der ganzen Sache widmeten auch die Luzerner Genossen Dr. Steiner, der
Administrator und spätere Nationalrat Weibel, sowie Buchdrucker
Müller ihre Mithülfe, vom Aargau die Genossen Otto Suter, Fuchs
und andere.
Der Druck des «Flügelrades» war eine wesentliche Hülfe
für meinen Betrieb in Olten. Zur Durchführung des ganzen Planes
musste ich grosse Anschaffungen machen: eine Zeitungsrotationsmaschine, eine
weitere Linotype, eine Schnellpresse usw. Im Druckereigebäude an der
Froburgstrasse musste nach kaum drei Jahren der Fertigstellung des Baues ein
grosser Maschinenraum ausgebaut werden. Kostenfolge über 50’000
Franken.
Mit der Entwicklung dieser Probleme entstand die Notwendigkeit der
Anstellung eines Redaktors für die tägliche Ausgabe des
gemeinsamen Hauptblattes. Damit wurde auch für die Solothurner die
Frage der Gründung einer eigenen Pressunion aktuell mit der
Übernahme der Herausgabe der «Neuen Freien Zeitung» in
Selbstverlag.
Im Sommer 1911 kam die Wahl des Redaktors Jacques Schmid an die Reihe.
Letzterer wirkte als jüngerer Redaktor am Zürcher
«Volksrecht». Jacques Schmid und Frau hatten Mühe, sich mit
der Vertauschung Zürichs mit Olten als neues Wirkungsfeld zu befreunden
und es bedurfte des persönlichen Besuches meinerseits, um diesen
Beschluss zur Reife zu bringen. So kam die tägliche Ausgabe der
«Neuen Freien Zeitung» am 1. Juli 1911, des «Freien
Aargauers» und des Zentralschweizerischen «Demokrat» Ende
1911 zur Verwirklichung.
Mit dem Zustandekommen der solothurnischen Pressunion, zu deren Führung
die Genossen Bösiger und Schindelholz gewählt wurden, ging der
Verlag der «Neuen Freien Zeitung» kostenlos in das Eigentum der
Solothurner Pressunion über. Sie übernahm die Administration und
Verwaltung sowie die Expedition der «Neuen Freien Zeitung».
Leider ergab das erste Jahr 1912 ein Defizit von 12’000 Franken,
veranlasst durch eine etwas zu gross angelegte Inserate-Acquistion. Schon im
zweiten Jahre wurde das Ergebnis besser, dank der guten Voraussetzungen, die
nun vorhanden waren.
Unsere Erwartungen bei den Kantonsratswahlen 1912 wurden enttäuscht.
Redaktor Jacques Schmid widmete sich seiner Aufgabe mit viel Erfolg und
Eifer, hielt viele Vorträge und fand Beifall in den Kreisen der
Genossen. Da war es gar nicht verwunderlich, dass die Freisinnigen vor den
Wahlen des Kantons Solothurn in Olten einen Aufmarsch von 5000 Mann,
Tannzweige am Hute, zur Propaganda organisierten, um gegen die
Sozialdemokraten und die Schreibweise der «Neuen Freien Zeitung»
zu protestieren.
Die Aargauer und Luzerner Genossen konnten sich mit ihren Blättern,
täglich zu sechs Seiten, sehen lassen und auch demgemäss
entwickeln. Sie hatten nun ein Organ, das den Lesern viel bot und
während des Ersten Weltkrieges mächtige Hilfe brachte. Das gleiche
war im Kanton Solothurn der Fall. Die «Neue Freie Zeitung» drang
auch im obern Kantonsteil durch. In der Folge ist die «Volkswacht am
Jura», herausgegeben von Genosse Guldimann in Grenchen, mit der
solothurnischen Pressunion und der «Neuen Freien Zeitung»
verschmolzen worden.
Der 1914 ausbrechende Weltkrieg drohte zuerst zu einer Gefahr für die
Parteizeitungen zu werden. Die Schwierigkeiten lösten sich aber wieder
auf und in der Folge wurde ein Erstarken der sozialdemokratischen Zeitungen
daraus.
Am Kriegsende 1918/1919 konnten die drei Pressunionen ein so starkes
Aufblühen der Zeitungen feststellen, dass sie zum Bau von eigenen
Druckereien überzugehen vermochten. Das war auch im Kanton Solothurn
der Fall. Aus dem Privatbetrieb der Druckerei in Olten wurde nun ein
separater Genossenschaftsbetrieb, die
«Genossenschafts-Druckerei» in Olten. Auch diese kann bei dem
50jährigen Jubiläum der Zeitungsgründung auf das respektable
Alter von 36 Jahren zurückblicken. Die «Neue Freie Zeitung»
wurde bei diesem Anlass umgetauft in «Das Volk».
Ohne Schwierigkeiten ist es aber auch beim Genossenschaftsbetrieb nicht
abgegangen. Trotzdem ging es aufwärts! Im grossen und ganzen darf man
mit den Errungenschaften zufrieden sein. Die Arbeiterorganisationen sind zu
machtvoller Blüte emporgewachsen, das Lebensniveau der Arbeiterschaft
und der ganzen Welt hat sich stark gehoben. Auch heute noch ist grosse
Arbeit zu leisten. Immer neue Probleme sind zu lösen. Dazu muss die
Arbeiter- und Genossenschaftspresse immer stärker das ihrige beitragen.
Neue Gefahren sind aufgetaucht. Mit viel gutem Willen und planvollem Handeln
wird es möglich sein, auch in Zukunft zu guten Resultaten zu gelangen.
Unterdessen ist der Gründer der «Neuen Freien Zeitung» dem 80. Lebensjahr nahegerückt. 1955. Mit viel Freude kann er auf die Gründung und das Wachsen der solothurnischen Arbeiterpresse zurückblicken, aber auch auf den Erfolg seiner Tätigkeit, die «Neue Freie Zeitung» gegründet und bis zum Tagblatt entwickelt zu haben. Dazu war er imstande, das wertvolle Verlagsrecht der Zeitung samt Abonnentenbestand und Inseratenwesen ohne jegliche Kosten der solothurnischen Pressunion zu überlassen, auf guter Grundlage zum Erfolg. Der Gründer jedoch musste nun selber sehen, wie er mit seiner Druckerei weiterkam, nach 15jährigen Kampf für die «Neue Freie Zeitung».
1 Friedrich Trösch, * 2.2.1851 Thunstetten, † 25.1.1896 Herzogenbuchsee [Quelle: Burgerrodel Thunstetten III, 375].
2 1888 erwarb Burkhard Fischer (1857–1938) von seinem Patron Druckerei und Verlag der «Emmentaler Nachrichten» in Münsingen [aus: Ernst Burkhard, Dorf und Herrschaft Münsingen in alter Zeit, Münsingen 1962, 82].
3 Frühling 1893.
4 Jakob Burri.
5 Maria Anna Trösch, geb. Burri, * 17.10.1847 Bützberg, † 13.8.1929 Bern [Quelle: Burgerrodel Thunstetten III, 375].
6 Herbst 1899.
7 1899–1901/1902.
8 1902.
9 1902.
10 Bis 1904.
11 Flora Trösch, * 13.3.1887 Herzogenbuchsee, ∞ 1910 Ernst Reinhard [Quelle: Burgerrodel Thunstetten III, 375].
12 Ernst Trösch, * 18.5.1879 Herzogenbuchsee, † 1.10.1943 Bern [Quelle: Burgerrodel Thunstetten III, 375].
|
|
|
e-mail
Links |